Wettlauf im Orbit: Michael Gahler MdEP lobt hessische Weltraumstrategie
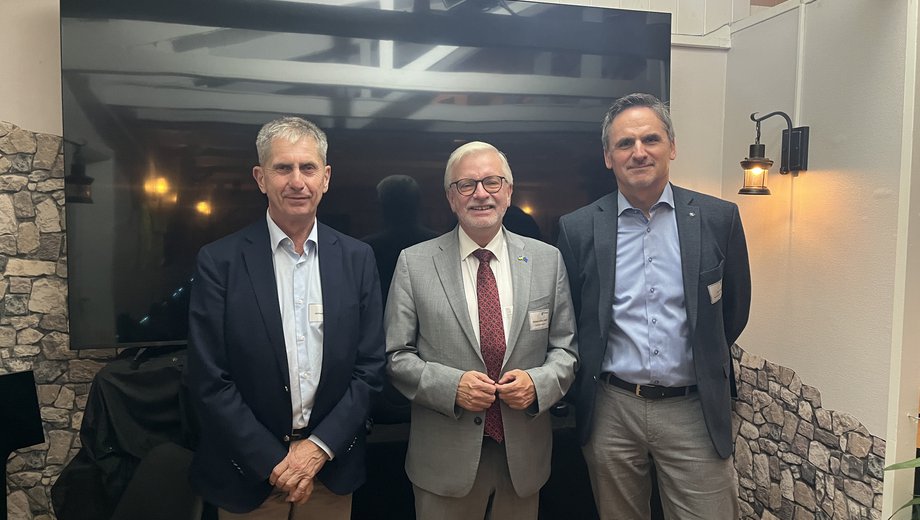
Mit einem kurzen Grußwort eröffnete Tino Klinger, Sektionssprecher Odenwald, die Veranstaltung und führte in ein hoch aktuelles Thema ein: In einer Zeit globaler Krisen und wachsender Spannungen werde der Aufbau sicherer, unabhängiger Kommunikationswege zur strategischen Herausforderung – und der Weltraum rücke zunehmend ins Zentrum dieser Debatte. Die Dominanz des US-amerikanischen Starlink-Systems unter Elon Musk weise dabei nicht nur technische Überlegenheit, sondern auch politische Abhängigkeiten auf.

In seinem Impulsvortrag machte Michael Gahler MdEP, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung des Europäischen Parlaments, unmissverständlich klar: Europa müsse im All mehr Eigenständigkeit entwickeln – und Hessen könne dabei eine Schlüsselrolle einnehmen. Gahler wies darauf hin, dass Hessen als eines der wenigen Bundesländer über eine eigene Raumfahrtstrategie verfüge und mit einem zentralen Weltraumzentrum wichtige Impulse setze. Doch die Realität sei ernüchternd: Die Unterschiede im Raumfahrtbudget zwischen der EU und den USA seien eklatant. Dabei habe sich spätestens im Ukrainekrieg gezeigt, wie essenziell robuste und resiliente Weltrauminfrastruktur sei. Starlink habe der Ukraine nicht nur im Kampfgeschehen, sondern auch im zivilen Bereich eine stabilere Internetverbindung ermöglicht als viele europäische Länder im Alltag vorweisen könnten.
Der Weltraum werde jedoch nicht allein aus wirtschaftlichen Gründen relevanter. Auch die NATO sehe ihn längst als neue Kampfzone. Daher sei er ein Schauplatz, in dem Kommunikationssatelliten und strategische Infrastruktur gezielt geschützt werden müssten. Der rechtliche Rahmen hingegen sei bedenklich, Waffenstationierungen im All seien bisher nicht ausdrücklich verboten, internationale Vereinbarungen bestenfalls rudimentär.

Mit seiner fundierten Expertise in Raumfahrtthemen, technologischer Entwicklung und Digitalisierung ergänzte Michael Schmidt die Veranstaltung um eine wertvolle analytische Perspektive. In seinem Beitrag beleuchtete er vor allem die beiden zentralen EU-Projekte IRIS² und GOVSATCOM. Darüber hinaus warf Schmidt einen Blick auf zukunftsweisende Technologien, die künftig eine Schlüsselrolle in der Raumfahrt einnehmen könnten – darunter lasergestützte Kommunikation, softwaredefinierte Satelliten, moderne Verschlüsselungstechnologien und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Besonders anschaulich wurde sein Plädoyer für eine leistungsfähige Kommunikationsinfrastruktur anhand des Beispiels Landwirtschaft: Ob autonome Maschinen oder Präzisionslandwirtschaft mit KI-gestützter Navigation – ohne digitale Vernetzung lasse sich das Innovationspotenzial kaum ausschöpfen.
Den Schwerpunkt seines Vortrags legte Michael Schmidt jedoch auf die strukturellen Voraussetzungen, die Europa für mehr technologische Unabhängigkeit schaffen müsse. Zwei Faktoren hob er dabei besonders hervor: Zum einen die starke Regulierung in Europa – etwa im Rahmen des EU AI Acts –, die zwar ethische Maßstäbe setze, aber zugleich die technische Entwicklung ausbremsen könne. Man müsse nicht immer standardisieren, um zu standardisieren. Zum anderen den vergleichsweise geringen Grad an Risikobereitschaft in der europäischen Industrie. Im Unterschied zu den USA, wo private Unternehmen mit hoher Dynamik agierten, dominiere in Europa oft ein vorsichtiger, nachhaltigkeitsorientierter Ansatz.